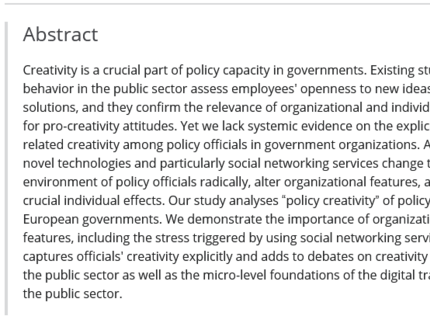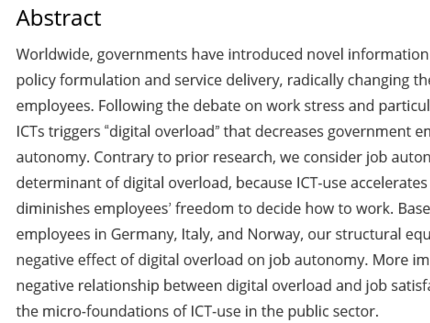Neuer Artikel zu Kreativität in der Politikformulierung in Public Administration Review
Julia Fleischer und Camilla Wanckel haben einen Artikel über „Policy Creativity“, insbesondere in Zeiten der digitalen Transformation in Public Administration Review veröffentlicht. Für ihre Studie befragten sie Ministerialbürokraten und Ministerialbürokratinnen in Deutschland, Italien und Norwegen zum organisationalen Klima für Innovation in ihrer Behörde, ihrer Motivation im öffentlichen Dienst sowie ihrem wahrgenommenen Stress bei der Nutzung von sozialen Medien. Es zeigt sich, dass „Social Media Stress“ die individuelle Kreativität in Prozessen der Politikformulierung beeinträchtigt, während ein organisationales Klima für Innovation sowie eine hohe Motivation die Kreativität positiv beeinflussen. Die Umfragedaten wurden im Rahmen des EU Horizon 2020 Forschungsprojektes TROPICO (Transforming into Open, Innovative and Collaborative Governments) erhoben.
Zum Artikel geht es hier.
Neuer Artikel zu 'Digital Overload' in der Ministerialbürokratie in Review of Public Personnel Administration
Julia Fleischer und Camilla Wanckel haben einen Artikel zum Einfluss einer „digitalen Überlastung“ auf die wahrgenommene Autonomie und somit auf die Arbeitszufriedenheit von Ministerialbürokraten und Ministerialbürokratinnen in Deutschland, Italien und Norwegen in Review of Public Personnel Administration veröffentlicht. Ihr Konzept des „Digital Overload“ beinhaltet mit seinem Fokus auf Techno-Overload“ auf der einen und „Communication Overload“ auf der anderen Seite zwei Dimensionen, die den Arbeitsalltag der Ministerialbürokratie in Zeiten der digitalen Transformation verändern und, wie sich zeigte, durch beschleunigte Routinen und Unterbrechungen in Prozessen der Politikformulierung die individuelle Autonomie und Arbeitszufriedenheit verringern. Die Umfragedaten wurden im Rahmen des EU Horizon 2020 Forschungsprojektes TROPICO (Transforming into Open, Innovative and Collaborative Governments) erhoben.
Zu dem Artikel geht es hier.
Prof. Dr. Julia Fleischer erhält ERC Consolidator Grant
In der jüngsten Runde der ERC-Grants war Prof. Fleischer erfolgreich und hat einen ERC Consolidator Grant für ihr Forschungsprojekt „STATE-DNA“ erhalten.
Das Projekt „Evolutionary Government: Origins and Consequences of Structural Change in Government“ (STATE-DNA) widmet sich den formalen Strukturen in Regierungsorganisationen und untersucht deren Veränderungen auf Ebene der einzelnen Organisationseinheiten innerhalb von Ministerien und nachgeordneten Behörden.
Die Ursachen und Auswirkungen dieses Strukturwandels werden in verschiedenen Debatten diskutiert: Als Komponenten einer (administrativen) Staatskapazität, als Unterbau von ministeriellen Portfolios oder als Elemente von Regierungsorganisationen und Akteure in der exekutiven Politikgestaltung.
STATE-DNA verbindet diese Perspektiven und begreift die Organisationseinheiten als „Bausteine“ des modernen Staates, die somit auch aus evolutionsbiologischer Perspektive untersuchbar sind. Entsprechend wird das ERC-Projekt neue Theorien und Methoden nutzen, auch aus den Naturwissenschaften, um die Ursachen und Wirkungen von Strukturveränderungen in Frankreich, Deutschland, Japan, Niederlande, Norwegen und Großbritannien von 1815 bis 2025 zu analysieren.
Der ERC Consolidator Grant ist mit einer Fördersumme von ca. 2 Millionen Euro verbunden und das Projekt hat eine Laufzeit von 5 Jahren.
Lernen Sie mehr über unser Projekt auf unserer State-DNA-Webseite