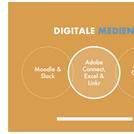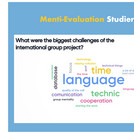Intercultural Math & Data Reporting (E-Learning Award 2019)
Claudia-Susanne Günther
(wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Didaktik der Mathematik)
Angaben zum Praxisbeispiel:
In dem 4-wöchigen Projekt „Intercultural Math & Data Reporting“ werten 17 Potsdamer Lehramtsstudierende gemeinsam mit 9 brasilianischen Journalismus-Studierenden der Pontifíca Universidade Católico do Rio Grande do Sul (PUCRS) in Porto Alegre statistische Datensätze auf ihre gesellschaftliche Relevanz aus. Neben der Anwendung ihrer Kenntnisse in theoretischer Statistik werden die Potsdamer Studierenden durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Themen wie Datenvisualisierung und civic statistics in Berührung kommen. Die Lernziele dieses Projektes gehen je nach Lerngruppe in verschiedene Richtungen: Während für die brasilianischen Journalismus-Studierenden die Arbeit mit den Datensätzen und die Aufspürung gesellschaftlich relevanter Information im Vordergrund stehen, stellt für die Potsdamer Studierenden das Projekt zu Beginn ihres Seminars „Sprachsensibler Mathematikunterricht“ vor allem eine Möglichkeit zur Selbsterfahrung dar, als Nichtmuttersprachler an (interdisziplinären) Lehr- und Lernsituationen teilzunehmen. An diese Selbsterfahrung schließt sich im Seminar für die Potsdamer Studierenden eine theoretische Beschäftigung mit dem Thema Sprachsensibles Unterrichten und eine ebenfalls 4-wöchige Praxisphase an, in welcher die Seminarteilnehmenden ihre theoretischen Kenntnisse anwenden und mit ihren internationalen Erfahrungen verbinden können, um geflüchtete Mathematiklehrerinnen und -lehrer des Refugee Teacher Programs zu unterrichten.
Das Projekt „Intercultural Math & Data Reporting“ und sein Rahmenseminar richten sich an Studierende des Faches Mathematik im Lehramt für die Sekundarstufen und für die Primarstufe.