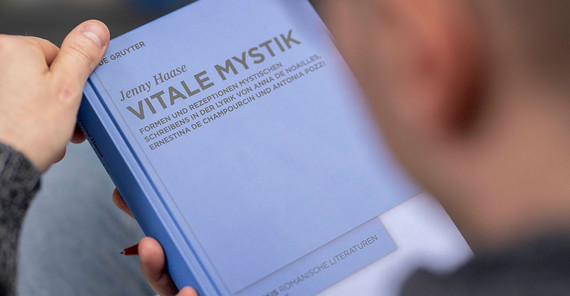Ein weites, aber auch lohnendes Feld, auf dem Jenny Haase ganz eigene Schwerpunkte setzt und interdisziplinär forscht: Lyrik der Moderne, feministische Erzählstimmen, post- und dekoloniale Diskurse, Religion und Säkularisierung sowie lateinamerikanische Ökokritik in der Gegenwartsliteratur. Gemeinsam mit ihren Studierenden liest die Wissenschaftlerin zeitgenössische französischsprachige Romane, diskutiert Performance- und Videokunst aus Lateinamerika, lädt Gäste zu Vorträgen ein oder spricht über umweltpolitische Krisen im globalen Zusammenhang.
Ob Lithiumabbau in der Atacama-Wüste, expandierende Lachsfarmen vor der Küste von Chile, Holzwirtschaft oder Staudamm-Projekte auf indigenem Land – wie verhandeln Künstler*innen aus dem Globalen Süden ökosoziale Krisen? Ist eine andere Sichtweise auf Lateinamerika möglich, für die wir in Europa bislang möglicherweise blind waren? Und wie können sich beide Perspektiven im Dialog gegenseitig und auf Augenhöhe bereichern?
Diese und andere Fragestellungen zu einer Vielzahl an Themen in einer Professur unterzubringen, ist in den akademischen Strukturen anderer Länder gar nicht so einfach. „In den USA etwa sind viele Themengebiete, die wir in der Romanistik zusammenfassen, getrennte Disziplinen“, sagt die Wissenschaftlerin, die als Postdoktorandin zwei Jahre an der Stanford University weilte. „In der deutschen Romanistik haben wir einerseits eine philologische Tradition und zugleich eine kulturwissenschaftliche Perspektive, wie sie in der Lateinamerikanistik vorherrscht. Beides ergänzt sich gut.“
Expertin für Literaturen und Kulturen der „globalen Romania“
Auch sie selbst vereint diese beiden Qualitäten in sich. Die Literaturwissenschaftlerin Jenny Haase etwa untersucht in ihrer Habilitationsschrift „Vitale Mystik“ die Werke moderner Schriftstellerinnen auf mystische Elemente, die aus dem Katholizismus entlehnt und von den Autorinnen transgressiv überformt werden. Die Forschungsarbeit wurde von der Universität Freiburg mit dem Hugo Friedrich und Erich Köhler-Preis gewürdigt.
Die Faszination für fremde Sprachen und Kulturen begleitet die 46-Jährige seit ihrer Jugend. Bereits in der Schule lernt Jenny Haase Englisch, Französisch und Spanisch, im Studium später auch Italienisch und Katalanisch. Als Teenager geht sie zum Schüleraustausch sechs Monate nach Frankreich. Bevor sie zum Studium erst nach Göttingen, dann nach Barcelona und Berlin zieht, lebt die junge Frau ein halbes Jahr lang in Santiago de Chile, reist mit dem Rucksack durch den Andenstaat und lässt sich von den Menschen und ihrer Kultur begeistern.
Eine Begeisterung und Lust, die sie heute ihren Studierenden mitgeben möchte. „Leben und Arbeit ist in unseren Forschungsfeldern oft nicht klar voneinander zu trennen, und für die Romanistik gilt das, so glaube ich, im Besonderen. Hier in Potsdam ist das Fach stark am Lehramtsstudium für Spanisch und Französisch ausgerichtet. Es ist wesentlich, dass die angehenden Lehrer*innen nicht nur Kenntnisse der Sprachen und Kulturen vermitteln, sondern auch die Begeisterung dafür, dort persönliche Erfahrungen zu sammeln.“
Lateinamerikanische Stimmen hörbar machen
Da spricht dann die Lateinamerikanistin Jenny Haase, die immer wieder in Länder wie Kolumbien oder Chile reist, und der es der südliche Zipfel des Kontinents ganz besonders angetan hat. Was andere allenfalls mit Outdoor-Klamotten oder exotischen Vorstellungen assoziieren, ist für Jenny Haase ein kulturwissenschaftlicher Forschungsgegenstand. Noch als Studentin fängt sie an, Texte und Romane mit Patagonien-Bezug zu sammeln.
Die Region und das bisweilen abenteuerromantische Bild, das die europäische Literatur davon zeichnet, hat Haase in ihrer Promotionsarbeit kritisch untersucht. Allen voran der Bestseller „In Patagonia“ des britischen Schriftstellers Bruce Chatwin. Auf seinen Spuren reist Jenny Haase in den 2000er Jahren mit neugierigem Blick durch das Land. Dabei betrachtet sie die Region sowohl von außen als auch durch die Augen argentinischer und chilenischer Schriftsteller*innen. Ihre an der Berliner Humboldt-Universität eingereichte Doktorarbeit „Patagoniens verflochtene Erzählwelten: Der argentinische und chilenische Süden in Reiseliteratur und historischem Roman (1977–1999)“ wird 2009 mit dem Elise Richter Preis des Deutschen Romanistikverbands ausgezeichnet.
Im Dezember 2025 plant Jenny Haase gemeinsam mit Kolleg*innen aus Südamerika, den USA und Deutschland eine Konferenz zu posthumanistischen Ansätzen aus lateinamerikanischer und indigener Perspektive. Gemeint ist das Infragestellen anthropozentrischer Weltbilder durch andere Sichtweisen auf den Menschen als ein Subjekt, das mit seiner Umwelt unauflösbar verflochten ist. Schließlich kommen aus dem Globalen Süden wichtige Impulse für die Geisteswissenschaften.
„Aus lateinamerikanischer Perspektive werden etwa die Zusammenhänge zwischen sozialer, politischer, ökonomischer und ökologischer Krise viel stärker betont“, sagt Jenny Haase. „Es gibt auch ein größeres Bewusstsein für Machthierarchien, die oft der postkolonialen Situation geschuldet sind.“ Nicht zuletzt bereichert der Blick auf indigene Philosophien, die ein ganz anderes Mensch-Natur-Verständnis aufzeigen, als es meist bei uns der Fall ist.
Jenny Haase ist seit 2024 Professorin für Romanische Literaturwissenschaft (Französisch/Spanisch) an der Universität Potsdam.
Weitere Informationen zu Neuberufenen an der Universität Potsdam:
https://www.uni-potsdam.de/de/up-entdecken/upaktuell/personalia/neu-ernannt
Dieser Text erschien im Universitätsmagazin Portal - Eins 2025 „Kinder“.