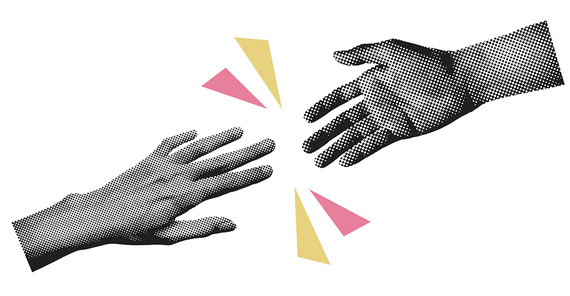1.
In einem Land, das in den Rankings der weltweiten Demokratien weit oben rangiert, nehmen wir freie Wahlen, freie Meinungsäußerung, Gleichheit vor dem Gesetz und die politische Teilhabe für Bürgerinnen und Bürger allzu oft für selbstverständlich. Doch ein Blick in die Welt zeigt: Die Antidemokraten haben Konjunktur. Es gibt heute weniger demokratische Gesellschaften als Autokratien, liberale Demokratien gelten als gefährdete Art. Fast drei Viertel aller Menschen leben in mehr oder weniger autoritären Gesellschaften, und die Zahl der autokratisch geprägten Länder steigt.
2.
Immer wieder ereignen sich Rückfälle in autoritäre Zustände, häufig angestoßen durch politische Eliten, die etablierte ethisch-normative Prinzipien verletzen. Die vielen Grenzüberschreitungen von US-Präsident Donald Trump sind ein anschauliches Beispiel dafür. Wenn politische Eliten signalisieren, dass ein solches normverletzendes Verhalten akzeptabel ist, tendiert die Öffentlichkeit eher dazu, ihrerseits antidemokratische Überzeugungen und Verhaltensweisen anzunehmen. „Forschungen zeigen etwa, dass gewisse Bevölkerungsteile deutlich xenophober werden, wenn sie wissen, dass in ihrem Wahlkreis Donald Trump die Mehrheit der Wählerstimmen gewonnen hat“, sagt Christoph Abels.
3.
Eine Radikalisierung gegen demokratische Grundprinzipien wird durch eine Kombination aus Populismus, Fehlinformation und Polarisierung begünstigt. „Wir wissen allerdings aus der Risikoforschung, dass es eine Lücke zwischen Beschreibung und Erfahrung gibt. Risiken, die mir nur beschrieben werden, unterschätze ich tendenziell, während ich Risiken, die ich selbst erlebt habe, eher überschätze.“ Um die Demokratie zu retten, reicht es deshalb nicht aus, ihren drohenden Untergang zu beschwören. Damit demokratische Verhaltensnormen nicht einrosten, braucht es: Training.
4.
Ein wirksames Instrument, um den Rückgang von Demokratien zu stoppen, sind Verhaltensinterventionen. Sie zielen darauf ab, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Manipulation und Fehlinformationen zu erhöhen, die individuelle Entscheidungskompetenz zu stärken und Vorurteile gegen gesellschaftliche Gruppen abzubauen.
5.
Eine weitere, gut dokumentierte Verhaltensintervention bringt Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und sozialen Gruppen zu konkreten Themen ins Gespräch. „Das kann man auch angenehm gestalten, wie ein Bierwerbespot für Heineken gezeigt hat“, sagt Christoph Abels. „Dafür wurden Menschen mit konträren Ansichten in einen Raum gesetzt, ihnen ein Bier in die Hand gedrückt und eine Unterhaltung angestoßen.“
6.
Eine pädagogische Methode, die das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung ins Feld führt, ist das Boosting: „Dabei handelt es sich um kurze Interventionen, die den Menschen konkrete Fähigkeiten vermitteln“, erläutert Christoph Abels. „Etwa wie man die Glaubwürdigkeit von Quellen überprüft. Oder das sogenannte Pre-Bunking, also das Erkennen von Falschinformationen anhand von bestimmten Markern in der Sprache und Botschaft von Inhalten.“
7.
Menschen in einem entspannten Umfeld miteinander in Kontakt bringen: Das geht im Vereinsleben, durch ehrenamtliches Engagement oder im Rahmen von betrieblichen Veranstaltungen. „Die aus meiner Sicht effizienteste Maßnahme ist, das am Arbeitsplatz zu machen“, sagt Politikforscher Abels. „Denn viele andere Anlässe, zu denen Menschen noch physisch zusammenkommen, bauen sich sukzessive ab. Wer ist denn noch im Gemeindechor oder geht in die Kirche und spricht dort mit anderen Leuten?“
8.
Diesen Interventionen zugrunde liegt die Theorie des Intergruppenkontakts aus den 1950er Jahren. Sie besagt, dass Vorurteile gegen die andere Gruppe dem realen Kontakt mit dieser nicht standhalten. „Und Studien zu derartigen Interventionen zeigen genau das“, so der Wissenschaftler. „Wer Menschen miteinander an einen Tisch bringt und so sympathische Narrative erzeugt, der hilft auch, polarisierenden Überzeugungen zu begegnen, die letztlich dem demokratischen Zusammenleben schaden.“
9.
Den Demokratiebegriff durch interaktive Formate greifbar machen: Das kann auch spielerisch gelingen. Das können Rollenspiele oder auch virtuelle Simulationen (zum Beispiel eines Überwachungsstaats) sein, in denen spürbar wird, was es heißt, in einem autokratischen System zu leben. Nicht zuletzt die bildende Kunst kann eine wichtige Funktion dabei übernehmen, den gegensätzlichen Lebenswirklichkeiten in demokratischen und politisch unfreien Gesellschaften eine ausdruckstarke Form zu verleihen.
10.
Auch die Wissenschaften sind in einer Bringschuld, wenn es darum geht, das Vertrauen der Gesellschaft in demokratisch organisierte Forschung und Bildung zu fördern. Denn wer Wissenschaftsfreiheit genießt, hat auch die Verantwortung, den Elfenbeinturm zu öffnen. Dafür braucht es niedrigschwellige Formate, in denen die breite Öffentlichkeit etwas über die Arbeit an den Hochschulen und akademischen Instituten erfährt, die durch die öffentliche Hand mitfinanziert oder überhaupt erst möglich gemacht wird.
Dieser Text erschien im Universitätsmagazin Portal - Zwei 2025 „Demokratie“.