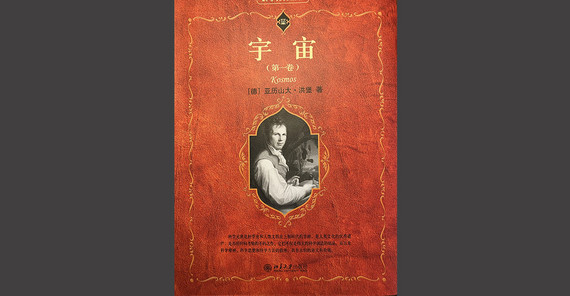Alexander von Humboldt war niemals in China. Was verband ihn dennoch mit dem chinesischen Reich?
Nach seiner Rückkehr von der Reise in die amerikanischen Tropen im Jahr 1804 war es Humboldts Lebenstraum, Zentralasien zu erkunden. Er nahm in der Folgezeit mehrfach Kontakt zu den Briten auf. Doch die hüteten sich, ihn nach Britisch-Indien zu lassen, da er zuvor den spanischen Kolonialismus stark kritisiert hatte. Er lebte nun fast ein Vierteljahrhundert in Paris und bereitete sich von dort auf die Reise nach Asien vor: Der Gelehrte hatte Kontakt mit Sinologen und informierte sich über den chinesischen Bergbau, über Mythologie, Feste und Gebräuche des Reiches, aber auch über das geografische Wissen Chinas, das weit besser war als das der Griechen oder Römer und der europäischen Welt bis ins Mittelalter. Als er 1829 immerhin bis zur chinesischen Grenze kam, tauschte er Geschenke mit Beamten der Qing-Dynastie aus, unter anderem einen der klassischen Romane der chinesischen Literatur, „Geschichte der Drei Reiche“, der uns sogar erhalten geblieben ist.
Welche Bedeutung hat seine russisch-sibirische Reise für uns heute?
Zwar steht heute die amerikanische Reise im Vordergrund. Aber Humboldts jahrzehntelange Beschäftigung mit Asien ist wichtig, um zu verstehen, wie er globale Visionen entwickelt – etwa Prognosen zum Klimawandel. Unser Verständnis von Isothermen, mit deren Hilfe auf meteorologischen Wetterkarten die Gebiete gleicher Temperatur gekennzeichnet werden, geht auf den Naturforscher zurück. Auf seinen Überlegungen basieren heute unsere Weltklimakarten. Humboldt hatte sich schon damals für die Einrichtung weltweiter Messstationen eingesetzt. Die Texte von der russisch-sibirischen Reise sprechen auch von den Veränderungen des Klimas durch die Bodenerosion, ähnlich wie auf der amerikanischen Reise, als er die industriellen Gase, die in die Atmosphäre gelassen wurden, beobachtet hatte. Und er erkannte, dass der Umgang der Menschen mit der Natur kulturell bedingt ist. Schon auf der amerikanischen Reise berichtete der Forscher über Versuche, weite Gebiete in Mexiko und Venezuela zu entwässern. Er erkannte, dass die Trockenheit um den venezolanischen Valencia-See auch durch den Umgang der Spanier mit Wasser verursacht wurde, die es ableiteten – weil sie es offenbar nicht genug schätzten. Dadurch gelangte weniger Wasserdampf in die Atmosphäre und es wurde trockener rund um den See. Noch heute sind die Auswirkungen des Menschen auf die Natur der Region deutlich sichtbar. Auch die Holzwirtschaft der Kolonialmächte brachte der Gelehrte in Zusammenhang mit der Trockenheit in der Region. Er konnte solche Verbindungen präzise wahrnehmen, weil er Kultur und Natur zusammendachte. Auf diese Konstellation driften wir langsam wieder zu, weil sich ihre Trennung in der westlichen Wissenschaft als Fehler herausstellt: Zur Bewältigung der Klimakrise müssen wir die Kulturwissenschaften heranziehen. Heute geht es ganz ähnlich wie zu Humboldts Zeiten darum, die unterschiedlichen Kulturen zu überzeugen, dass sie klimatischen Veränderungen entgegentreten müssen.
Wie entstand die Idee, Alexander von Humboldt in China bekannt zu machen?
Das Forschungszentrum ist vor gut drei Jahren gegründet worden, und zwar ausschließlich aus chinesischen Mitteln. Die deutsche Wissenschaftspolitik ist zunehmend krisenabhängig und ich wollte etwas schaffen, das von den deutsch-chinesischen Beziehungen unabhängig ist. Ich habe zunächst Kontakte aufgebaut zu Germanistiken an Universitäten in Shanghai, Peking und Chongqing und versucht, in Vorträgen und Workshops an Humboldt heranzuführen. In China wurde seine amerikanische Reise 1832 rezipiert, im 20. Jahrhundert spielte er jedoch keine Rolle. Alle chinesischen Kolleginnen und Kollegen haben mir deswegen vom Aufbau eines Forschungszentrums abgeraten: Der deutsche Forschungsreisende sei für das Land nicht interessant. Ein solche Einschätzung spornt mich an, denn sie ist ein sicheres Indiz, dass es da etwas Interessantes zu erforschen gibt. Und im Oktober 2023 haben wir den ersten Humboldttag gefeiert – mit drei Vorträgen aus Deutschland und fünf aus China. Wir konnten drei Promotionsstipendien einrichten, eine Doktorandin ist derzeit hier in Potsdam. Vor Kurzem habe ich sie zur Disputation meiner letzten Doktorandin an der Universität Potsdam mitgenommen – da hat sich ein Zyklus von über 50 betreuten Dissertationen und Habilitationen in den letzten Jahrzehnten geschlossen. Inzwischen hat die Übersetzerin Gao Hong außerdem Humboldts Werk „Kosmos“ übertragen. So wie es aussieht, werden sieben bis acht weitere seiner Werke ins Chinesische übertragen. Das ist eine traumhafte Situation.
Haben Sie Ihr ursprüngliches Terrain als Romanist verlassen, wenn Sie sich nun China zuwenden?
Ich habe das Konzept der transarealen Studien, die Literatur im Kontext der Globalisierung erforschen, entwickelt. Als Komparatist bin ich mit dem chinesischen Forschungszentrum also immer noch zu Hause. Nun habe ich erstmals einen Vortrag über chinesische Literatur gehalten, das war für mich etwas Besonderes. Ich beobachte auch die wachsenden Verbindungen zwischen Lateinamerika, China und Europa. Für China ist Südamerika wirtschaftlich sehr wichtig geworden, umgekehrt ist es genauso. In der Volksrepublik lernen Menschen jetzt zunehmend Deutsch, Französisch und Spanisch anstelle von Englisch. Hier eröffnet sich eine ganze Hemisphäre. Wir haben bereits zwei virtuelle Tagungen zwischen den drei Kontinenten mitveranstaltet. Ich bin zwei Mal jährlich für zwei Monate in Fernost und lerne aus dieser Perspektive sehr viel über Europa.
Sie haben die schwierigen wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China angesprochen. Haben Sie manchmal Sorgen, zwischen die Fronten zu geraten?
Die politischen Auseinandersetzungen haben so direkte Auswirkungen auf die wissenschaftliche Betätigung, dass einem das Blut in den Adern gefriert. Konflikte werden zunehmend auf politisch-wirtschaftlicher Ebene ausgetragen. Dieses Problem bestand auch immer schon, was meine wissenschaftlichen Beziehungen zu Kuba betrifft. Ich habe jedoch überhaupt keine Angst, zwischen die Fronten zu geraten. Humboldt ist hier ein sicherer Hafen. Und die Chinesinnen und Chinesen haben ein riesiges Interesse an europäischen Partnern. Allerdings ist es für deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht immer leicht, nach China zu kommen, und auch umgekehrt benötigt die Antragstellung für einen Forschungsaufenthalt in Deutschland mindestens ein Dreivierteljahr. Deutschland hat eine katastrophale Kulturaußenpolitik, wie aktuell die Schließung von neun Goethe-Instituten zeigt. Im Vergleich mit Alexander von Humboldts oder Gottfried Wilhelm Leibniz’ Kenntnissen über das chinesische Reich ist unser Wissen über das Land in den heutigen digitalen Zeiten sehr gering.
Nach so vielen Jahren der wissenschaftlichen Auseinandersetzung – besteht die Gefahr, dass Sie Humboldt eines Tages überdrüssig werden?
Bei Humboldt geht es mir wie bei Martí: Es gibt immer Neues zu entdecken! Wissenschaft ist einfach faszinierend. Wenn ich irgendwann nicht mehr in der Lage sein sollte zu forschen, weiß ich, dass es viele andere Menschen gibt, an die ich den Enthusiasmus für die Wissenschaft weitergeben konnte. Und so lange ich lebe, wird auch meine Faszination für die Forschung bleiben. Mein Ziel ist es, die Verbindung zwischen Potsdam und China zu stärken, und inzwischen hängt das Interesse an Humboldt in Fernost nicht mehr von mir ab. Genügend chinesische Forschende tragen die Flamme weiter.
Vielen Dank für das Gespräch!
Dieser Text erschien im Universitätsmagazin Portal - Eins 2024 „Welt retten“ (PDF).