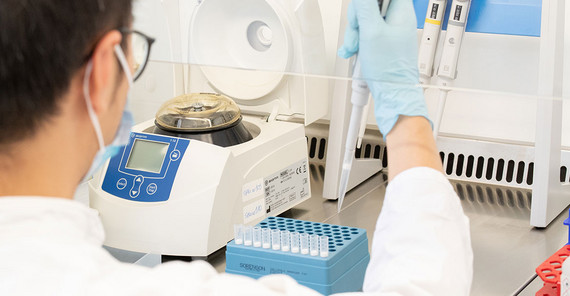„Das Setting ist exakt genormt“, erklärt Pia-Maria Wippert, Professorin für Medizinische Soziologie und Psychobiologie. Genormt für Stresstests, die hier im Labor, das die Wissenschaftlerin eigens für ihre Forschung eingerichtet hat, regelmäßig durchgeführt werden. Wie Stress entsteht und vor allem wie er sich auswirkt, zählt zu den Forschungsschwerpunkten der Wissenschaftlerin. Doch dafür muss er zuallererst erzeugt und natürlich erfasst und analysiert werden.
„Der Test soll Stress auslösen“, erklärt die Forscherin. „Denn den wollen wir messen.“ Das erfolgt unter anderem in Form des Hormons Cortisol, das uns leistungsfähig macht, wenn es darauf ankommt. In solchen Situationen setzt der Körper neben Cortisol auch Noradrenalin und Adrenalin frei. Mit ihrer Hilfe erhält das Gehirn schnell Glukose, damit wir konzentriert und belastbar sind. Cortisol steigert zudem den Blutdruck, beschleunigt die Atemfrequenz und lässt das Herz schneller pumpen. Gleichzeitig wirkt das Stresshormon positiv auf das Immunsystem ein und hemmt Entzündungsprozesse. Nachweisbar ist es beispielsweise im Speichel. Deshalb werden vor, während und nach dem Test – je nachdem, worauf die Forschenden gerade schauen – bis zu acht Speichelproben genommen, um zu bestimmen, wie sich der Cortisolspiegel entwickelt. Da es einige Zeit dauert, ehe das Hormon im Körper wirkt, beginnt der Stresstest eigentlich schon vor dem Gespräch: Die Testpersonen bereiten sich allein vor, im Ungewissen darüber, was kommt. Schon hier legt der Körper den Schalter um. Zehn Minuten später geht es dann richtig los.
Drei Personen betreten den Raum, nehmen auf den Stühlen hinter dem Tisch Platz, legen Dokumente vor sich ab. Anschließend kommt ein junger Mann herein, wird gebeten, sich vor ihnen ans Mikrofon zu stellen. Er wirkt angespannt, bemüht, ruhig zu bleiben. Die drei vor ihm schauen streng, ausdruckslos. Das hilft sicher nicht. Er wird aufgefordert rückwärts zu rechnen, zügig. Er wirkt sichtlich angestrengt, die Prüfenden unzufrieden. Schon das Zuschauen stresst. Wie mag es dem „Prüfling“ gehen?
Stress hat sein Gutes – in Maßen
„Tatsächlich erleben wir Stressreaktionen auf verschiedenen Ebenen“, sagt Pia-Maria Wippert. „Emotional etwa, unsere Stimmung ist davon direkt betroffen, aber auch kognitiv, denn wir bewerten und durchdenken die Situation unmittelbar.“ Die am häufigsten mit Stress verbundene physiologische Reaktion wiederum ist selbst komplex. Immerhin sind fünf Hormonachsen beteiligt und geraten durch die Ausschüttung von Cortisol & Co. – durchaus gewollt – ins Ungleichgewicht. Denn Stress ist nicht per se schlecht, macht die Wissenschaftlerin deutlich. „Wir brauchen eine gewisse Anspannung, um uns an verschiedene Situationen anpassen zu können. Wenn wir gesund sind und ausreichend Ressourcen haben, sind wir dann auch nicht ‚gestresst‘, sondern entwickeln uns weiter.“ Eigentlich verfügt unser Körper über Systeme, eigene Feedback- schleifen, mit denen er die Cortisolausschüttung beenden und das Gleichgewicht wiederherstellen kann. Zum Problem wird Stress, wenn er uns auf dem falschen Fuß erwischt, wenn unser Körper zu oft oder zu starken Stressspitzen ausgesetzt ist. Besonders Kinder und Jugendliche sind dafür in bestimmten Entwicklungsphasen anfällig, erklärt Pia-Maria Wippert. „Gerade in den frühen Phasen unserer Entwicklung verändert sich das Gehirn stark und steht im direkten Austausch mit der Ausbildung der Hormonachsen. Starke Stressreaktionen, etwa durch ein frühkindliches Trauma, können zu einer Dysfunktion, das heißt zu einer Umprogrammierung des Funktionslevels der Hormonachsen führen und damit lebenslang Auswirkungen haben.“ Aber auch Erwachsenen tut Cortisol- Dauerfeuer nicht gut. „Wenn es keine Ruhephasen mehr gibt, in denen der Körper ins Gleichgewicht findet, oder aber ein schwerwiegendes Ereignis zu sehr starken Stressreaktionen führt, gibt es Überbeanspruchungs- und Abnutzungseffekte.“ Dass wir unter Dauerstress in die Knie gehen, wird in der Forschung „allostatische Last“ genannt. Diese wiederum kann uns krankmachen, und zwar auf verschiedenste Weise: Inzwischen werden Herz-Kreislauf-, Autoimmun-, psychische und Diabetes-Erkrankungen ebenso mit Stress in Verbindung gebracht wie Schädigungen der Knochen, der Zellregeneration, des Verdauungstrakts und der DNA. Stress macht uns buchstäblich kaputt.
Stress macht uns auf mehreren Ebenen krank
Pia-Maria Wippert erforscht unter anderem, was Stress mit unseren Knochen „anstellt“ – und hat Verblüffendes festgestellt: „Wir konnten zeigen, dass sich bei Menschen mit hoher Stressbelastung der Knochenstoffwechsel umstellt und die Dichte der Knochen abnehmen kann.“ Diese wachsen langsamer, brechen schneller und heilen schlechter. Generell leide bei viel Stress die Fähigkeit zur körperlichen Regeneration. Dabei zeigten sich sogar unterschiedliche Muster der Schädigung: „Menschen mit Kindheitstrauma haben ein anderes Muster als jemand mit Dauerstress“, so die Forscherin.
Ein zweiter wichtiger Schwerpunkt des Teams gilt der Frage, wie sich Stress auf andere wichtige Erkrankungen auswirkt, etwa solche, die unsere Muskeln und das Skelett betreffen. „Schmerzerkrankungen sind weltweit die ‚Nummer 1‘. Und sie werden zunehmen“, so die Wissenschaftlerin. „Aktuell leiden weltweit allein rund 540 Millionen Menschen an unspezifischen Schmerzen im unteren Rücken.“ In verschiedenen Projekten wie „MiSpEx“ oder aktuell „RENaBack“ hat sie mit ihrem Team erforscht, wie Stress die Entstehung chronischer Schmerzen befeuert. Das passiert tatsächlich auf verschiedenen Wegen, wie zum Beispiel einer gewebsstoffbedingten Veränderung der Nervenfaserqualität, einer Neurotransmitter-Dysbalance oder einer zunehmenden neuronalen Aktivierung in Hirnzentren, die gleichzeitig in die Verarbeitung von Stress- und Schmerzreizen eingebunden sind.
Um die genauen Mechanismen dahinter zu verstehen, haben die Forschenden mittlerweile bis zu über 5.000 Personen aus der Allgemeinbevölkerung sowie Patientinnen und Patienten von Reha-Kliniken untersucht: Sie analysierten Blut, Haar und Urin sowie microRNA auf Stressmarker. Zudem wurden Betroffene umfassend befragt und oft über mehrere Jahre begleitet. „Es ist uns so gelungen, die Zahl möglicher psychosozialer Einflussfaktoren, die für den Übergang einer akuten Schmerzepisode in einen chronischen Verlauf wichtig sind, von 250 auf acht zu reduzieren“, sagt die Forscherin. „Eine wichtige Rolle spielen etwa die soziale Situation, vitale Erschöpfung, kritische Ereignisse und eben Stress“, vor allem Faktoren, die für das Kohärenzgefühl eines Menschen bedeutsam sind. Daraus entwickelte das Team eine Diagnostik als Frühwarnsystem und eine Intervention, die den Betroffenen dabei hilft, ihr dauerhaft aus dem Gleichgewicht geratenes System wieder zu stabilisieren – durch moderates, individuell angepasstes Training. „Schmerzpatienten sind oft gar nicht in der Lage zu trainieren“, so die Forscherin. „Aber es geht genau darum, sie in Bewegung, ins Training zu bekommen, damit das System wieder anspringt.“ Die Diagnostik hilft, entlang des persönlichen psychosozialen Risikoprofils die richtigen Therapiebausteinen für ein multimodales Training zu finden. Dieses enthält Module, die körperliche Aktivierung mit kognitiver verbinden: Patienten müssen dabei sportliche Übungen ausführen und gleichzeitig Aufgaben lösen, die das Abeitsgedächtnis trainieren. „MRT-Aufnahmen haben gezeigt, dass dadurch der frontale Kortex aktiviert wird und gleichzeitig die Aktivität im Schmerznetzwerk nachlässt“, erklärt Pia-Maria Wippert. Die auf diesem Weg provozierten neuen neuronalen Aktivierungsmuster löschen Schmerzspuren und ermöglichen, Menschen im schmerzfreien Bereich zu trainieren. Betroffene vergessen den Schmerz also buchstäblich über den Aufgaben, nehmen ihn nicht richtig wahr. „Und sie werden dabei auch noch schlauer, weil sich der Stoffwechsel im Hirn verändert und die Verarbeitungsgeschwindigkeit zunimmt.“ Auch das Signalprotein BDNF, wichtig für die Regeneration von Nerven, verändert sich. Wichtig sei aber, das Training individuell anzupassen – ausgehend von der Analyse der Schmerzursachen, die das Team erarbeitet hat.
Inzwischen ist der Stresstest abgeschlossen, der junge Mann „entlassen“. Jetzt geht die Arbeit hinter der Spiegelglasscheibe erst richtig los: Hier liegt das eigentliche Labor von Pia-Maria Wippert. Denn das Team analysiert die Speichelproben direkt vor Ort, führt die Ergebnisse mit den Auswertungen der Videoaufnahmen zusammen. Nur so sind die groß angelegten Studien vor Ort möglich, mit denen die Forscherin dem Stress zu Leibe rücken will.
Der Forscherin
Prof. Dr. Pia-Maria Wippert ist Professorin für Medizinische Soziologie und Psychobiologie an der Universität Potsdam.
E-Mail: pia-maria.wippertuuni-potsdampde
Die Projekte
Im 2011 gegründeten „National Research Network for Medicine in Spine Exercise“ (MiSpEx) haben sich deutschlandweit 13 Universitäten und Kliniken zusammengeschlossen, um Rückenschmerzen zu erforschen: im interdisziplinären Forschungsprojekt „Ran Rücken – Aktiv gegen Rückenschmerz“ (2011–18), das von der Universität Potsdam koordiniert wurde (Gesamt-PI Prof. Mayer). Ziel war die Entwicklung, Evaluation und der Transfer einer funktionsbezogenen Diagnostik, Prävention und Therapie bei Rückenschmerzen für den Spitzensport und die Gesamtgesellschaft. Prof. Dr. Pia-Maria Wippert und ihr Team waren für das psychometrische Messsetup und die psychometrischen Methoden für alle drei multizentrischen Studien verantwortlich.
Im Projekt „RENaBack“ wurden multimodale Interventionsbausteine in der Nachsorge von Rückenschmerzpatienten entwickelt und erprobt. Ziel war ein auf das eigene psychosoziale Risikoprofil zugeschnittenes personalisiertes Therapieprogramm, das Patientinnen und Patienten in der Regelzeit der klinischen Rehabilitation erlernen und als Nachsorge zu Hause selbstständig durchführen können.
Zum Weiterlesen
Aktuelle Publikationen von Pia-Maria Wippert und ihrem Team zum Thema Puerto Valenica, L., Arampatzis, D., Beck, H., Dreinhöfer, K., Drießlein, D., Mau, W., Zimmer, J-M., Schäfer, M., Steinfeldt, F. & Wippert, P.-M. (2021).
RENaBack: Study Protocol for a Multicenter, Randomized Controlled Trial for low back pain patients in rehabilitation. Trials, 22:932. https://doi.org/10.1186/s13063-021-05823-3
Wiebking, C., Lin C.-I., Wippert, P.-M. (2022). Training intervention effects on cognitive performance and neuronal plasticity. Frontiers in Neurology, Neurore- habilitation. 5;13:773813. https://doi.org/10.3389/ fneur.2022.773813
Dieser Text erschien im Universitätsmagazin Portal - Zwei 2023 „Mentale Gesundheit“ (PDF) und Portal Wissen - Eins 2024 „Bildung:digital“ (PDF).