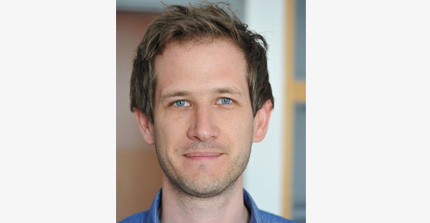Wissenschaft und Forschung
Für alle, die sich so mit ihrem Studium identifizieren, dass sie auch abends in der Bar noch mit ihren Freund*innen über die erlernten Theorien debattieren und auf jeder Bahnfahrt in Texte ihrer Disziplin vertieft sind oder am Wochenende ins Labor eilen, um nach ihren Proben zu schauen, bietet sich eine berufliche Tätigkeit in Wissenschaft und Forschung an.
Für diese benötigt man üblicherweise eine an den regulären Studienabschluss anschließende Promotion. Promotionsinteressent*innen können dabei zwischen verschiedenen Möglichkeiten zur Verwirklichung ihres Promotionsvorhabens wählen.
Möglichkeiten der Promotion
Nach abgeschlossener Promotion stellt sich die Frage, ob man seine Wissenschaftskarriere an der Hochschule weiterverfolgen, an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung arbeiten oder in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Unternehmen einsteigen möchte. In letzteren beiden Fällen kann man sich einfach direkt nach Abschluss der Promotion auf geeignete Stellen bewerben (siehe Stellsuche unten). Je nach Disziplin und Ausschreibung arbeitet man dann an konkreten Forschungsprojekten mit oder entwickelt bzw. optimiert marktreife Produkte wie etwa in der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie oder Medizinindustrie. Dementsprechend hoch sind, insbesondere in den privatwirtschaftlichen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, die Schnittstellen zu Professionen wie der Qualitätssicherung, der Produktentwicklung oder dem Patentwesen, etc.
Eine Alternative zu direkten Forschungstätigkeiten ist außerdem die Anstellung in wissenschaftsnahen Tätigkeitsfeldern wie der Wissenschaftskommunikation, dem Wissenschaftsmanagement oder dem Wissens- und Technologietransfer.
Entscheidet man sich für eine klassische Universitätskarriere muss man sich üblicherweise auf eine lange Reihe befristeter Verträge einstellen, bis man weiß, ob man am Ende eine der begehrten Professuren bekommt. Dies entscheidet sich laut dem Stellen- und Ratgeberportal academics.de oft erst im Alter von 40 oder 50 Jahren. Stellt man dann am Ende der Karriere fest, dass es nicht für eine eigene Professur reicht, kann es schwer werden, auf dem außeruniversitären Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, weswegen es sinnvoll sein kann, einen Plan B in der Tasche zu haben. Wer sich trotz dieser Hürden für eine universitäre Wissenschaftskarriere entscheidet, sollte sehr ausdauernd und motiviert sein, für sein Thema brennen und eine gewisse Durchsetzungskraft mitbringen. Je früher man damit beginnt, in Fachzeitschriften Artikel zu veröffentlichen, Tagungen zu besuchen und Beziehungen zu anderen Wissenschaftler*innen zu knüpfen, desto besser ist es für die eigene Karriere. Bei Fachtagungen können Beziehungen gepflegt und Drittmittelgeber*innen akquiriert werden.
Der Weg einer solch klassischen Universitätskarriere führt dabei immer von der Promotion über die Habilitation bis zur hoffentlich am Ende liegenden eigenen Professur.
Universitäre Wissenschaftskarriere - von der Promotion zur Professur
Egal ob in der außeruniversitären Forschung oder für eine wissenschaftliche Hochschulkarriere, empfiehlt es sich, sich schon früh im Studium wissenschaftlich zu profilieren und Kontakte zu knüpfen. Hierfür können Sie gezielt Tätigkeiten als wissenschaftliche Hilfskraft annehmen, an Summer Schools und Tagungen teilnehmen und durch Haus- und Abschlussarbeiten versuchen, frühzeitig einen eigenen Forschungsschwerpunkt zu definieren. iIealerweise gelingt es Ihnen auch, schon erste Texte und Paper zu veröffentlichen - z. B. über die Beteiligung an einem Sammelband der eigenen Professor*innen.
Auch bieten die außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie Forschungsabteilungen von Unternehmen Praktika, Werkstudent*innenstellen und Masterarbeiten an, durch die man gezielt versuchen kann, mit seinem Thema in der entsprechenden Organisation Fuß zu fassen.