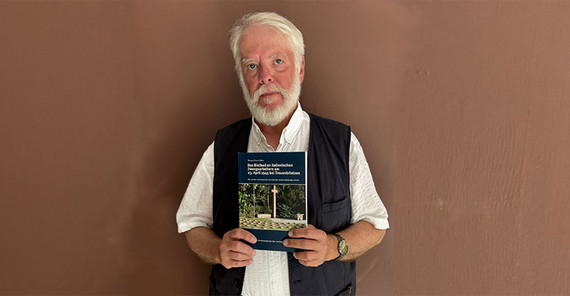Was steht in Ihrem Buch – in drei Sätzen?
Was uns die Erinnerung von Zeitzeug*innen und die Archive über ein Gewaltverbrechen aus der Endphase des Zweiten Weltkriegs sagen und wie wir noch mehr darüber herausfinden können. Was bei der Strafverfolgung mehr als ein halbes Jahrhundert lang falsch gelaufen ist. Und es enthält nicht nur Text, es sind auch Bilder im Buch: Von dem heute so friedlich erscheinenden Ort der Tat im märkischen Sand, von der Bergung der Opfer 1945 und von ihren letzten Ruhestätten.
Hat Ihr Buch eine Geschichte?
Als ich vor einem Vierteljahrhundert in einer lokalen Zeitung von diesem unfassbaren Verbrechen las, habe ich mir vorgenommen: Eines Tages schaust Du, was Du darüber findest und für die Nachwelt noch zusammenstellen kannst. Das habe ich jetzt endlich gemacht – siehe Untertitel.
Warum ist Ihr Buch wie kein anderes?
Es bietet die erste systematische Rekonstruktion des mikrohistorischen Themas.
Sie veröffentlichen im Universitätsverlag Potsdam – und damit open access. Warum?
Mit der Einladung der Brandenburgischen Historischen Kommission zur Veröffentlichung in der Schriftenreihe „Arbeiten zur brandenburgischen Orts- und Regionalgeschichte“ lagen Verlag und Form der Publikation fest. Zum Glück! Denn neben dem guten alten und hier auch aufwendig gestalteten Buch bietet open access schnellen Zugriff und Verbreitung. So geht Zukunft.
Wer sollte Ihr Buch lesen – und wann?
Alle historisch Interessierten, die sich (zu welcher Tages- oder Lebenszeit auch immer) vor Augen führen mögen, wohin das „Othering“ führt, wenn völkischer Wahn zur Exklusion aufstachelt. Das Gewalttabu jenseits des staatlichen Monopols ist anthropologisch keine Konstante: Auch deshalb muss Geschichte erforscht und aufgeschrieben und auch auf diese Weise festgehalten und erinnert werden, gerade soweit sie im Einzelnen einfach nur zum Fürchten ist.
Was lesen Sie selbst?
Lieber Bücher aus Papier als Texte im Netz. Über Verbrechen aus der Endphase des Zweiten Weltkrieges. Bücher zur Geschichte (zurzeit über Finnland) und zur Kultur- und Kunstgeschichte – seit einiger Zeit von und über Max Imdahl, einem Bildwissenschaftler (1925–1988), der die alten Werke der gegenständlichen Malerei angeschaut hat, als wären sie abstrakt! Mag seine Sprache auch aus der Zeit gefallen sein, so scheint mir sein Konzept – die „Ikonik“ – noch immer originell.
Was hat Spaß gemacht beim „Buchmachen“ – und was eher nicht?
Beim Forschen und Schreiben bin ich bei mir selbst, auch wenn das Thema das Blut in den Adern gefrieren lässt. Die Bitte des Verlages um Bilder hat mir noch die Erfahrung beschert, mit Nachkommen aus Italien in einen Austausch über historische Bilddokumente zu kommen. Dabei ging es auch um Nachkommen einer Gruppe von Freiwilligen, die erst Monate nach der Tat die Toten am Tatort bergen und bestatten konnten. Für mich sind diese 19 Freiwilligen wahre Helden der Humanität. Das hat alles auch Spaß gemacht!
Auf einer Skala von 1 bis 10: wie gut ist Ihr Buch?
Beurteilen können das immer nur die Leser*innen.
Wenn Sie könnten: Würden Sie sich für das Buch einen Preis verleihen – und wenn ja, welchen?
Das Buch ist zur Erinnerung an das schreckliche Geschehen und an die Opfer und nicht dazu da, dafür dekoriert zu werden. Natürlich freue ich mich über Hinweise und freundlich-fachlichen Austausch zur Sache.
Und nun noch 3 Sätze zu Ihnen …
Promotion in Politischer Wissenschaft und Berufsweg in der Ministerialbürokratie. Als nunmehr freier Forscher und Autor bleibe ich bei dem Thema und habe für die, die’s interessiert, noch „20 Thesen und Themen zur weiteren Forschung“ ins Netz gestellt. Zu finden auf meinen Account bei Researchgate.
„Zehn Fragen für ein Buch“ öffnet die Tür zum Potsdamer Universitätsverlag und stellt regelmäßig Neuerscheinungen vor. „Das Blutbad an italienischen Zwangsarbeitern am 23. April 1945 bei Treuenbrietzen: was wir über ein Verbrechen vom Ende des Zweiten Weltkriegs wissen“ ist online hier verfügbar und kann hier als Buch bestellt werden. Weitere Neuerscheinungen aus dem Universitätsverlag hier.