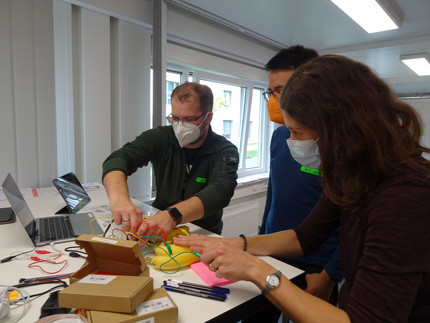Was bleibt vom Bildungscampus?
1. Bilanz aus fünf Jahren Bildungscampus
Dem Bildungscampus ist es dank all dieser Aktivitäten, umfangreicher zielgruppenorientierter Kommunikation sowie Kooperations- und Partizipationsmöglichkeiten im Rahmen der Projektlaufzeit gelungen, nach innen und außen den „Bildungscampus” als Marke an der UP aufzubauen. In der Folge wurde das Projektteam in der letzten Projektphase aktiv um Unterstützung sowohl bei der Diffusion und Dissemination von Erkenntnissen als auch bei der Gestaltung von Netzwerkveranstaltungen und der Vermittlung von Kontakten gebeten. Darüber hinaus wurde die Transfer-Expertise des Teams u. a. bei universitätsinternen Strategieprozessen einbezogen.
Positiv zu vermerken ist auch, dass das Interesse an den Aktivitäten rund um die USP sowie an den Angeboten der Digital Labs innerhalb wie außerhalb der UP hoch war und stetig zunahm. Vor allem im Bereich der Dissemination und Diffusion von Erkenntnissen und ko-kreativ entwickelten Arbeitsergebnissen konnte der Bildungscampus durch seine unterschiedlichen Kommunikations- und Veranstaltungsformate Erfolge verzeichnen.
In eingeschränktem Maße ist es bisher gelungen, Entwicklungsprozesse sowie Implementationsarbeit an den Schulen in der Region anzustoßen. Diese beiden Formen des Transfers gelten im Bildungsbereich als die wirkungsvollsten, sind aber auch die komplexesten und bedürfen einer intensiven und konzertierten, sektorenübergreifenden Zusammenarbeit. Dank der Vernetzungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der UP sowie durch die Ergebnisse der ko-kreativen Arbeitsweise im Konzeptionsprozess der USP ist inzwischen auch eine Grundlage für diese Form des Transfers geschaffen. Für die weitere Entwicklung dieser Transferprozesse wurde mit der Erarbeitung einer neuen universitären Transferstrategie, die auch dezidiert auf Lehrkräftebildung und Bildungswissenschaften eingeht, eine Grundlage gelegt. Dabei muss besonders bedacht werden, dass Transfer im Bildungsbereich einer eigenen Logik folgt, die unabhängig von anderen Transferprozessen sowohl vom ZeLB als auch von der Hochschulleitung strategisch begleitet werden muss.
Insgesamt ist weiterhin festzuhalten, dass der Bildungscampus gute Beziehungen zu vielen relevanten Akteur:innen aufgebaut hat. Es ist aber auch klar, dass weiterhin Vernetzungsbedarf besteht, denn insbesondere zu Projektbeginn war diese Arbeit mühsam und langwierig. Dies dürfte u. a. auf eine uneindeutige strukturelle Anbindung innerhalb der UP, den Status eines Drittmittelprojektes sowie eine fehlende gemeinsame Vision jenseits der Projektstrukturen zurückzuführen sein. Für zukünftige Projekte mit einer derart zentralen Position in der Lehrkräftebildung und Bildungsforschung wäre es daher nützlich, bereits in der Konzeptionsphase alle relevanten internen und externen Akteur:innen einzubinden. Auf diese Weise können ein Commitment und eine sinnvolle Passung mit anderen Aktivitäten der UP gestellt und die Grundlage für eine dauerhafte Verankerung der Angebote über die Projektlaufzeit hinweg geschaffen werden.
2. Zur Zukunft der Universitätsschule Potsdam
Ein wesentliches Ziel des Konzeptteams der USP war es, die auf dem Papier entwickelte Schule zum Leben zu erwecken. Wichtige Schritte in Richtung einer Schulgründung wurden bereits gegangen. So wurde das in der ersten Hälfte des Förderzeitraums konzipierte Rahmenkonzept im Januar 2021 an die Stadt übergeben und ist seither im politischen Diskurs angekommen. Als ersten Meilenstein beschloss die Stadtverordnetenversammlung Potsdam am 23. Juni 2021 den neuen Schulentwicklungsplan und forderte darin die Bildungsdezernentin auf, mit der Universität Potsdam und dem Land Brandenburg Gespräche zur Realisierung der Schule aufzunehmen. Als Ziel wurde die „Erarbeitung eines genehmigungsfähigen Konzepts” und „die Ermittlung und Bereitstellung von Flächen, gegebenenfalls durch das Land” ausgegeben. Vor diesem Hintergrund konkretisiert sich seither die Option, die USP zunächst als Grundschule in öffentlicher Trägerschaft zu gründen. Entsprechend erfolgte ein Auftrag des MBJS an die UP, ein auf die Grundschule und den anvisierten Schulstandort zugeschnittenes Konzept zu erstellen. Dieses Konzept für eine Universitätsgrundschule wurde im Dezember 2021 dem MBJS sowie dem MWFK übergeben. Seither laufen konstruktive Gespräche zwischen der UP, den Ministerien und der Stadt Potsdam, die im Jahr 2023 durch Vertreter:innen der UP fortgeführt werden.
Neben den Gründungsbemühungen für eine Universitätsgrundschule arbeitete das multiprofessionelle Team weiter am Konzept für eine USP, die die Klassenstufen 1 bis 13 in den Blick nimmt und alle anerkannten Schulabschlüsse ermöglicht. Inwiefern die Gründung einer solchen umfassenderen Version der USP möglich sein wird, ist offen. Zu klären ist auch, wie zum einen mit den umfangreichen Ideen und Vorschlägen, die im Konzeptteam entwickelt wurden, über eine Veröffentlichung hinaus weiter verfahren wird und wie zum anderen die entstandenen Strukturen über den Konzeptionsprozess hinaus fortgeführt und zielführend genutzt werden können.
3. Zur Zukunft der Digital Labs
Mit Blick auf die Digital Labs ist eine Verstetigung am ZeLB vorgesehen. In 2023 wird es zunächst eine Interimslösung geben, um den Raum und die Technik verfügbar zu halten. Die Veranstaltungsformate können weitergeführt werden, sobald hierfür Ressourcen allokiert wurden. Um die Verwertung der Ende 2022 neu entstandenen di.mobi.box Musik abzusichern, findet diese zunächst eine Heimat in der Fachdidaktik Musik, bevor sie planmäßig ebenfalls ans ZeLB übergeben wird. Eine dauerhafte Lösung für die Digital Labs als universitäre Transferstruktur wird für 2024 angestrebt.onzeptionsprozess hinaus fortgeführt und zielführend genutzt werden können.
Eine dauerhafte Lösung für die Digital Labs wird für 2024 angestrebt. Inwiefern nach einer längeren Pause an die etablierten Formate angeknüpft werden kann, ist allerdings fraglich. Gegebenenfalls müssen das Gesamtkonzept sowie die unterschiedlichen Maßnahmen dann noch einmal vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen an der UP reflektiert und angepasst werden. Insbesondere wird hier zu überlegen sein, wie sich die Digital Labs und der im Zuge der 2022 neu etablierten Stiftungsprofessur „Digitale Bildung” geplante fakultätsübergreifende Forschungsschwerpunkt sinnvoll ergänzen können, sodass Synergien genutzt und Doppelstrukturen vermieden werden. Zudem wird eine Verzahnung mit den im Rahmen einer weiteren Förderung des BMBF neu an der UP entstehenden „Kompetenzzentren für digitales und digital gestütztes Unterrichten in Schule und Weiterbildung“ angestrebt.
4. Lessons Learned
Welche Erkenntnisse können aus den Erfahrungen der letzten fünf Jahre und den beschriebenen Aussichten auf Verstetigung der Transferaktivitäten des Bildungscampus gezogen werden? Folgende acht Erkenntnisse sind für den Bildungscampus von besonderer Bedeutung:
- FRÜHZEITIG STRATEGISCHE ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN: Transfer passiert nicht von allein, sondern bedarf bewusster Planung und Umsetzung. Zudem brauchen erfolgreiche Transferaktivitäten Zeit und einen langen Atem. Es gilt systematisch Netzwerke aufzubauen und Vertrauen zu gewinnen. Dazu gehört auch, dass Tranferagent:innen dauerhaft als verlässliche Partner:innen wahrgenommen werden. Entsprechend wichtig ist es, nachhaltige Strukturen zu entwickeln und zu etablieren. Dafür ist es notwendig, universitätsseitig strategische Verstetigungsentscheidungen zu treffen und personelle sowie finanzielle und räumliche Ressourcen für jene Strukturen und Prozesse zu allokieren, die durch zeitlich befristete Projektmittel erfolgreich aufgebaut wurden. n werden? Folgende acht Erkenntnisse sind für den Bildungscampus von besonderer Bedeutung:
- RELEVANTE AKTEUR:INNEN IN DEN ANTRAGSPROZESS EINBINDEN:Transferarbeit bedarf stets einer Kooperation zwischen Vertreter:innen unterschiedlicher Systeme. Damit eine solche Kooperation gelingen kann, sind eine gemeinsame Vision und ein Commitment der Transferpartner:innen von besonderer Relevanz. Zu diesem Zweck sollten bereits in der Antragsphase relevante interne und externe Akteur:innen einbezogen werden und die jeweiligen Rollen klar umschrieben sein.
- UNSICHERHEITEN AUSHALTEN UND FLEXIBLE STRUKTUREN SCHAFFEN:Transfer folgt keinen verlässlichen Gesetzmäßigkeiten, sondern ist stark von Inhalt und Kontext sowie den involvierten Personen abhängig und damit nur bedingt planbar. Transferagent:innen müssen sich auf diese besondere Dynamik einlassen und gegebenenfalls ihre Arbeit nachjustieren. Dementsprechend bedarf es aber auch einer gewissen Unsicherheitstoleranz sowie flexibler Finanzierungs- und Entscheidungsstrukturen, die einen reflexiven, nutzer:innenzentrierten Entwicklungsprozess unterstützen.
- RESSOURCEN FÜR DIE EINBINDUNG DER ZIELGRUPPEN VORHALTEN: Die Ausgangslagen der zahlreichen Transferpartner:innen im Bildungsbereich sind sehr unterschiedlich. Damit gehen, neben verschiedenen strukturellen Voraussetzungen, auch unterschiedliche Bedarfe und Bedürfnisse einher, die bei der Transferarbeit berücksichtigt werden müssen. Dabei ist jedoch klar, dass eine zentrale Instanz nicht die Anforderungen sämtlicher Akteur:innen im Blick behalten kann. Vor diesem Hintergrund sollten Projekte zielgruppenzentriert aufgestellt sein und allen relevanten Partner:innen frühzeitig die Möglichkeit zur Partizipation einräumen. Dies erfordert Zeit sowie finanzielle Ressourcen, da gegebenenfalls die Unterstützung durch eine neutrale Prozessbegleitung hilfreich sein kann.
- CHANGE AGENT:INNEN IDENTIFIZIEREN UND EINBINDEN: Um Transfer nachhaltig zu verankern, braucht es Fürsprecher:innen in Schlüsselpositionen. Eine Aufgabe von Transferakteur:innen ist daher zum einen die Identifikation dieser Change Agent:innen und andererseits deren strategische und effektive Einbindung. Gerade in politischen Prozessen kann es dabei entscheidend sein, zunächst Allianzen zu knüpfen, die es wiederum erlauben, den (hierarchischen) Strukturen anderer Akteur:innen gerecht zu werden.
- PROZESSE UND ERGEBNISSE KONSEQUENT UND TRANSPARENT DOKUMENTIEREN: Insbesondere im Projektkontext ist es schwierig, eine personelle Konstanz sicherzustellen. Umso bedeutender ist eine konsequente und transparente Dokumentation sämtlicher Projektaktivitäten. Dafür gilt es, eine für alle im Projekt nachvollziehbare und auch verbindliche Dokumentations- und Planungsstruktur zu schaffen, inklusive einer Einigung auf gemeinsame digitale Arbeitsmittel. Strukturen sollten nach Möglichkeit gemeinsam entwickelt werden, sodass die Bedarfe und Bedürfnisse der involvierten Personen Berücksichtigung finden und die Akzeptanz der Entscheidungen sichergestellt ist.
- TEAMARBEIT AUF AUGENHÖHE FÖRDERN: Um Transferaktivitäten erfolgreich zu entwickeln und umzusetzen, ist gute Teamarbeit ein entscheidender Erfolgsfaktor. Bei der Zusammenstellung des Teams sollte darauf geachtet werden, dass die Mitglieder grundlegende Vorstellungen guter Teamarbeit teilen und sich in ihren fachlichen und methodischen Kompetenzen ergänzen. Als erfolgskritisch hat sich zudem die Zusammenarbeit auf Augenhöhe herausgestellt – ohne teaminterne Hierarchien, stattdessen mit einer kompetenz- und interessengeleiteten gemeinsamen Verteilung von Rollen. In einer solchen Konstellation gelingt es umso besser, für das Team passende und als verbindlich verstandene Strukturen und Prozesse zu entwickeln.
- RAUM FÜR GEMEINSAMES LERNEN SCHAFFEN: Auch das beste Team kann sich verirren. Um sicherzustellen, dass alle noch in die gleiche Richtung laufen und diese Richtung auch stimmt, sollte die eigene Arbeit regelmäßig reflektiert und bei Bedarf Veränderungen vorgenommen werden. Das kann sowohl inhaltlich-strategische Aspekte betreffen als auch Fragen der Zusammenarbeit oder das methodische Vorgehen in einzelnen Arbeitspaketen. Für all diese Themen sollte sich das Team regelmäßige Reflexions- und Lernräume schaffen.
Literatur
Landeshauptstadt Potsdam (2021). Integrierte Kita- und Schulentwicklungsplanung Landeshauptstadt Potsdam 2021 bis 2026. Teil 2 Schulentwicklungsplanung. Online abrufbar: https://vv.potsdam.de/vv/Integrierte-Kita-und-Schulentwicklungsplanung-Landeshauptstadt-Potsdam-2021-bis-2026-Teil-2-Schulentwicklungsplanung.pdf [letzter Zugriff am 28. Oktober 2022].
Kultusministerkonferenz (2021): Lehren und Lernen in der digitalen Welt – Ergänzung zur Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 09.12.2021. Online abrufbar: https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2021/2021_12_09-Lehren-und-Lernen-Digi.pdf [letzter Zugriff am 28. Oktober 2022].